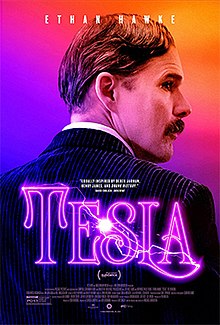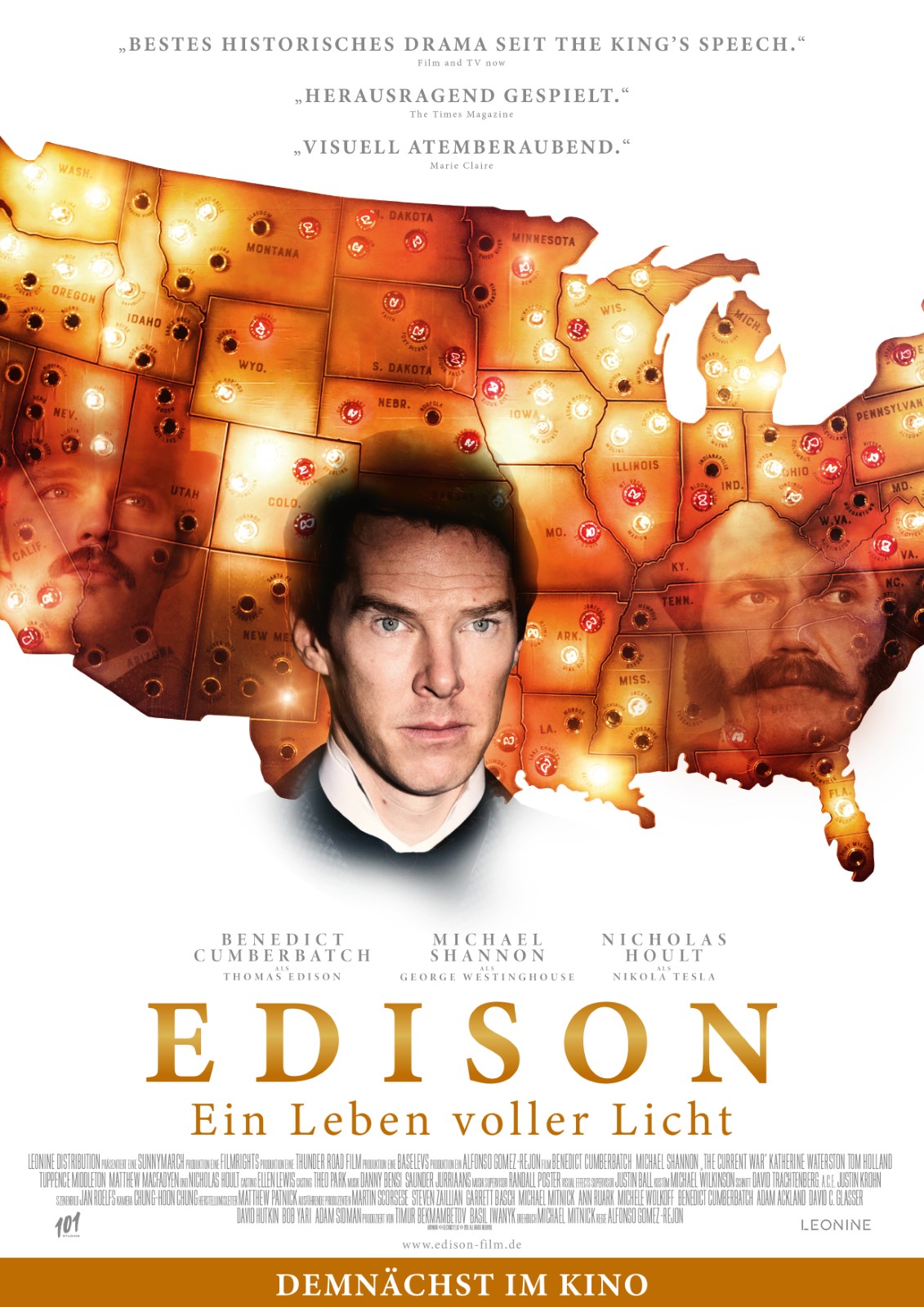X-MEN: THE NEW MUTANTS
Genre: Horror, Thriller, SciFi
Regie: Josh Boone
Cast: Maisie Williams, Any Taylor-Joy, Charlie Heaton
Laufzeit: 93 Minuten
FSK: ab 16 Jahre
Verleih: Walt Disney
 |
| (c) Walt Disney |
Inhalt:
In einer mysteriösen Klinik werden die Teenager Illyana (Anya Taylor-Joy), Sam (Charlie Heaton), Roberto (Henry Zaga) und Rahne (Maisie Williams) behandelt. Sie sind Mutanten und sollen angeblich unter der Anleitung von Dr. Reyes (Alice Braga) lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren, damit sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen. Doch nach der Ankunft der neuesten Patientin Dani Moonstar (Blu Hunt) leiden die übrigen Jugendlichen vermehrt unter Flashbacks, Albträumen und erschreckend realen Halluzinationen, was die ohnehin schon angespannte Situation unter den eingesperrten und wenige Freiheiten genießenden Teenagern noch weiter verschärft. Doch bald müssen sie feststellen, dass hinter ihrer Klinik mehr steckt, als sie bislang wissen. Die neuen Mutanten müssen nun ihre gegenseitige Skepsis ablegen und zusammenarbeiten, um gemeinsam mit vereinten Kräften zu überleben.
Bewertung:
Der eine oder andere Zuschauer wird „The New Mutants“ mit einem Gefühl der Neugierde und Vorfreude verlassen – nämlich auf das, was da jetzt kommt für diese neuen Mutanten, die keine „X-Men“ sind. Doch informierte Leser wissen bereits: Da folgt nix mehr! Obwohl sich das Coming-Of-Age-Horror-Drama phasenweise wie ein Prolog für ein komplett neues Kapitel anfühlt, ist der durch eine direkt übernommene Szene lose mit „Logan - The Wolverine“ verbundene „The New Mutants“ das endgültige Ende der bisherigen „X-Men“-Saga des mittlerweile von Disney übernommenen Studios Fox.
So muss man fast schon froh sein, dass der Film nach zahlreichen Verzögerungen und Problemen schon weit in der Vorproduktion nun überhaupt noch in die Kinos kommt. Dort ist er nun ein deutlich besserer Endpunkt der Mutantenfilmreihe, als es noch der misslungene „Dark Phoenix“ war – was vor allem an einem starken Cast rund um drei beeindruckende Hauptdarstellerinnen liegt und am Gespür von Regisseur Josh Boone für die Gefühle seiner jungen Figuren. Den oft angekündigten Horror sollte man aber nicht erwarten...
Auf dem Papier war es definitiv eine hervorragende Idee, Josh Boone mit „The New Mutants“ einen sich komplett vom Actionbombast der Hauptreihe abhebenden, ganz eigenen kleineren „X-Men“-Film als Horror-Drama mit jungen Protagonisten machen zu lassen. Der Gruselkost-Liebhaber und „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“-Regisseur scheint die perfekte Wahl, um diese zwei Welten zu vereinen. Und immer wieder ist in „The New Mutants“ zu spüren, dass die Genres so hochklassig hätten verbunden werden können wie im ersten Teil der jüngsten Adaption von „Stephen Kings ES“.
Doch am Ende überzeugt nur die eine Seite. Wie schon in seinen vorherigen Filmen beweist Boone nämlich erneut, dass er die (hier allerdings etwas weniger komplex dargestellten) Gefühlswelten von jungen Menschen auf der großen Leinwand erzählen kann. Wenn sich Dani und Rahne langsam annähern, ist dieses zarte Erwachen der ersten Liebe, sind die Schmetterlinge im Bauch der beiden jungen Frauen förmlich zu spüren. Der Regisseur muss seine Figuren nicht groß sprechen lassen, er findet die richtigen Bilder, eine wunderbar passende musikalische Untermalung und hat vor allem zwei großartige Darstellerinnen.
Insbesondere Maisie Williams beweist (in der Originalfassung mit ungewohntem schottischen Zungenschlag) einmal mehr, dass sie nach ihrem Durchbruch mit „Game Of Thrones“ und dem Ende der gefeierten Fantasy-Saga nicht so schnell wieder von der Bildfläche verschwinden wird. Der aufgrund ihrer Superheldenkräfte nicht unwichtige, mehrfach bemühte Blick in ihre Augen wird von ihr immer mit subtilem Minenspiel begleitet. Ohnehin ist der Cast ein Prunkstück. Anya Taylor-Joy („Emma.“) hat aufgrund ihrer extrovertierten Figur die sicher am stärksten herausstechenden Momente. Daneben meistert die aus der Serie „The Originals“ bekannte Blu Hunt in ihrer allerersten Kinorolle den Identifikationspart.
Durch ihre Augen lernen wir Zuschauer die mysteriöse Einrichtung kennen und fangen an, uns Fragen zu stellen. Was geht hier vor? Welche unterschiedlichen Kräfte haben all die jungen Patienten? Warum scheint Dr. Reyes allein das gesamte Personal zu bilden? Und was ist der wahre Zweck dieser Einrichtung, die ganz sicher keine Nachwuchs-X-Men ausbildet, wie die Jugendlichen anfangs noch spekulieren? Leider kommen auch hier die größten Schwächen ins Spiel. Boone versteht es zu wenig, uns mit diesen Mysterien zu fesseln, zu oft geht er viel zu platt vor.
Das macht sich schon in den Drama-Momenten negativ bemerkbar, wenn die Verschiedenheit und die einzelnen Charakteristika der fünf Jung-Mutanten beim ersten gemeinsamen Auftritt in einer Gruppentherapie ziemlich unelegant mit dem Holzhammer eingebläut werden. Gerade im Horror-Thriller-Teil ist es aber besonders schmerzhaft. Insbesondere ist die Visualisierung der Albträume zu oft zu stumpf auf einen schnellen Schockmoment hin aufgebaut, der dann mangels guter Vorbereitung nicht einmal eintritt. Selbst eine von Schockrocker Marilyn Manson vertonte, als Mischung aus russischem Mafioso und zähnefletschender Monster-Fratze gelungen designte Horror-Gestalt lässt nur erahnen, was hier möglich gewesen wäre.
„The New Mutants“ fehlt so die richtige Spannung. Das mit teilweise nur sehr durchschnittlichem CGI aufwartende Finale ist zudem eher von der Sorte belanglos, sodass selbst die kleineren etwas stärkeren Momente in dem eher uninteressanten Abarbeiten der vollen Präsentation der einzelnen Superkräfte untergehen. Der Showdown wirkt so eher wie eine Pflichtübung, eine Notwendigkeit, die eingebaut werden musste, weil das Publikum bei einer Superhelden-Comic-Verfilmung die große Schlacht am Ende gewöhnt ist. Aber irgendwie ist so ein Finale, das nicht so wirklich zum übrigen Film passen will, dann auch ein passender Abschluss für das „X-Men“-Franchise, bei dem über die Jahre ja auch sehr vieles nicht so richtig zusammenpasste.
Fazit:
Gelungene Comic-Of-Age-Geschichte trifft lahmen Horrorfilm. Da hätte man aus dem Part des Horrorfilms wesentlich mehr machen können, aber man wollte wohl die Tennie-Fans von Maisie Williams nicht verschrecken. Dennoch bekommt der Film 7,5 von 10 horrorfreie Punkte von uns. (mk)